Kalter Diamantenkrieg: Werden Laborsteine sabotiert?
Seit mehreren Jahren erlebt die Branche der im Bergbau gewonnenen Edelsteine eine beispiellose Krise. Sie wird erschüttert durch den historischen Preisverfall und den rasanten Aufstieg sogenannter Labor-Diamanten. Im Jahr 2023 sank der weltweite Gesamtwert der geförderten Rohdiamanten um 20 % auf rund 12,7 Milliarden US-Dollar, was einen historischen Tiefstand bedeutet. Diese Tendenz zeigt sich auch bei De Beers, dessen Umsatz aus dem Verkauf von Rohdiamanten im ersten Halbjahr 2024 um 21 % zurückging (Mining Technology, 2024). Es könnte kaum ein deutlicheres Zeichen für die strukturelle Entwertung des natürlichen Diamanten auf dem Weltmarkt geben. Diese doppelte Dynamik verdeutlicht die tiefgreifende Infragestellung eines Wirtschaftsmodells, das auf konstruierter Knappheit und Spekulation beruht, denn transparentere, ethischere und zugänglichere Alternativen verändern den Markt.
Der traditionelle Diamantenhandel organisiert sich neu
Angesichts dieses strukturellen Wandels scheinen Diamantenhändler und grosse Institutionen der Branche enger zusammenzurücken und eine Art gegenseitigen Schutz zu organisieren. Dabei entwickeln sie zunehmend skurrile, teils sogar verwirrende Strategien, um den medialen Raum zu fluten und den Markt unübersichtlicher zu machen. Diese Verwirrung ist keineswegs zufällig: Sie dient einer gezielten Erzählung, in der Labordiamanten wahlweise verharmlost, lächerlich gemacht oder als blosse Derivate abgetan werden, um die „positive“ Aura des Bergbaus zu bewahren.
Der Blick auf zwei aktuelle Initiativen, die keineswegs anekdotisch sind, legt die tiefen Spannungen einer Branche im Wandel offen. Durch ihre Untersuchung lässt sich besser verstehen, welche Kräfte im Hintergrund wirken – und warum es heute entscheidend ist, Marketingstrategien zu hinterfragen, die glänzende Edelsteine umgeben. Wir möchten etwas Licht auf diesen wichtigen Diskurs werfen.
AWDC-Initiative zur Banalisierung von Labor-Diamanten
Die jüngste Initiative des Antwerp World Diamond Centre (AWDC) – eine zweitägige Marketingkampagne in den Strassen von Antwerpen – bestand darin, Labor-Diamanten über einen Kaugummiautomaten für den symbolischen Preis von fünf Euro zu verteilen. Diese scheinbar spielerische Aktion entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine zutiefst abwertende Kommunikationsstrategie. Indem der Diamant mit einem billigen, kindlichen Spielzeug assoziiert wurde, versuchte das AWDC, diese Steine ihrer symbolischen Bedeutung zu berauben und sie fernab von Exklusivität, Prestige und Seltenheit zu positionieren.
Aufrechterhaltung einer künstlichen Hierarchie
Diese gezielte Banalisierung zielt nicht nur darauf ab, ein neues Publikum zu gewinnen, sondern vor allem darauf, Labor-Diamanten grundsätzlich zu delegitimieren. Der im Bergbau gewonnene Diamant soll weiterhin als Inbegriff von Authentizität gelten, während der Laborstein auf eine beiläufige, fast triviale Alternative reduziert wird. Der Kaugummiautomat wird so zum Symbol eines ideologischen Widerstands – zur kulturellen Verteidigung der Extraktion durch die Abwertung von neuem aussergewöhnlichem Schmuck.
Der Preis von fünf Euro lässt sich vermutlich durch die Verwendung sehr kleiner oder qualitativ schwacher Laborsteine erklären, was die Strategie der Banalisierung noch unterstreicht. Doch auch ein natürlicher Diamant vergleichbarer Qualität würde zu einem ähnlichen Preis gehandelt. Der niedrige Preis ist also kein spezifisches Merkmal synthetischer Steine, sondern schlicht Ausdruck der angebotenen Qualität – unabhängig von der Herkunft.
Unterstützung der Diffamierung durch Rapaport
Besonders aufschlussreich ist, dass die Aktion von Rapaport unterstützt wurde – einer zentralen Institution des Diamantenmarktes, die seit Jahrzehnten grossen Einfluss auf Preisbildung und Regulierung hat. Als Akteur, der historisch eng mit der traditionellen Industrie verbunden ist, trägt Rapaport aktiv dazu bei, die symbolischen und wirtschaftlichen Grenzen zwischen natürlichen und Labor-Diamanten zu festigen. Wie auch das Gemological Institute of America (GIA) spielt Rapaport eine entscheidende Rolle in diesem kalten Diamantenkrieg zwischen zwei Vorstellungen von Luxus: einer, die auf geologischer Seltenheit basiert, und einer, die auf technologischer Innovation beruht. Ihre Macht, Legitimität zu verleihen oder zu entziehen, prägt die Kräfteverhältnisse einer Branche, die sich längst neu ordnet.
Schreibt das GIA die Regeln rund um den Labor-Diamanten neu?
In einem ebenso strategischen wie symbolischen Schritt kündigte das Gemological Institute of America (GIA) – weltweite Referenz in der Gemmologie seit 1931 – den Abschied von den berühmten 4Cs (Cut, Color, Clarity, Carat) für die Bewertung von Labor-Diamanten an. Ab Ende 2025 sollen diese nicht mehr mit detaillierten technischen Zertifikaten versehen, sondern in vereinfachte Kategorien wie „Premium“ oder „Standard“ eingeteilt werden. Gilt ihre Qualität als unzureichend, bleiben sie gänzlich ohne Klassifizierung.
Offiziell begründet das GIA diese Entscheidung mit der zunehmenden Standardisierung der Labor-Diamanten, die in engen Qualitätsbereichen produziert werden. Inoffiziell offenbart dieser Bruch mit einem universellen Bewertungssystem den wachsenden Druck der traditionellen Diamantenhändler und Luxusmarken, die die symbolische und wirtschaftliche Vormachtstellung der Natursteine gegenüber modernen Schmuckläden wiederherstellen wollen.
Bedeutung dieser Entscheidung für ethisch gewonnene Labordiamanten
Diese Entscheidung ist alles andere als trivial. Das GIA, das historisch das Vertrauen der Öffentlichkeit in Edelsteine sichern sollte, bezieht nun offen Position in einem stillen Machtkampf zwischen zwei Formen von Legitimität: dem geologischen Wunder und der technologischen Reproduzierbarkeit. Gleichzeitig zeigt sich hier ein performatives Moment: Über ein Jahrzehnt lang wurden die 4Cs auf beide Arten von Diamanten angewandt. Sie stärkten so die Vorstellung, dass beide gleichwertig bewertet und wahrgenommen werden könnten. Dass der Bruch nun genau zu einem Zeitpunkt erfolgt, da der Diamantenmarkt stagniert, wirft Fragen auf.
Die Neudefinition der Standards scheint darauf abzuzielen, Labor-Diamanten als eigenständiges, vielleicht sogar ergänzendes Angebot zu positionieren. Denn wer die Bewertungskriterien verändert, verändert auch die Wahrnehmung – und damit den Wert. Durch seine quasi sakrale Autorität agiert das GIA nicht nur als Beobachter, sondern als gestaltende Kraft, die die Machtverhältnisse der zeitgenössischen Schmuckwelt neu ordnet.
Kampf um die Legitimation – nicht um die Natur
Am Ende dieser Analyse drängt sich eine Wahrheit auf: Zwischen im Bergbau gewonnenen und im Labor gezüchteten Diamanten besteht kein materieller oder ästhetischer Unterschied. Sie besitzen die gleiche chemische Zusammensetzung, gleiche Kristallstruktur und den gleichen Glanz. Und doch bemüht sich ein ganzes System darum, eine symbolische Grenze zwischen diesen beiden Realitäten zu konstruieren und aufrechtzuerhalten. Der Labor-Diamant, obwohl identisch in seiner Natur, bleibt vom elitären Kreis der „legitimen“ Juwelen ausgeschlossen.
Diese Ausgrenzung zeigt sich in institutionellen Entscheidungen mit weitreichenden Folgen. Beispielsweise werden Labor-Diamanten längst von zahlreichen internationalen Messen und gemmologischen Kongressen ausgeschlossen, die ausschliesslich Minensteinen vorbehalten sind. Diese Ausschlüsse beruhen nicht auf wissenschaftlichen Kriterien, sondern auf Fragen der Markenwahrnehmung, der wirtschaftlichen Macht und der Kontrolle über den dominanten Diskurs. Es geht darum, eine Bedrohung einzudämmen, die die etablierte Ordnung eines Marktes umstürzen könnte. Er basiert auf einer Vorstellung von kontrollierter Knappheit und unerschwinglichem Luxus.
Weshalb verdrängt der kalte Diamantenkrieg soziale und ökologische Folgen?
Dabei verdeckt die leidenschaftliche Verteidigung des natürlichen Diamanten eine ganze Schattenseite: die sozialen und ökologischen Folgen seiner Gewinnung. Trotz Kampagnen für „ethische Diamanten“ bleibt der Bergbau eng mit Konfliktzonen, Zwangs- und Kinderarbeit, massiver Abholzung, Grundwasserverschmutzung und der Enteignung lokaler Gemeinschaften verbunden. Hinter dem Glanz der Steine verbergen sich undurchsichtige Lieferketten mit verheerenden Auswirkungen – meist unsichtbar für die Endkundschaft.
Im Gegensatz dazu stehen Labor-Diamanten, rückverfolgbar, kontrolliert hergestellt und ohne zerstörerische Förderung – eine Alternative, die viele lieber zum Schweigen bringen, weil sie wissenschaftlich nicht zu widerlegen ist. Trotz aller Versuche der Industrie, eine undurchlässige symbolische Grenze zwischen geförderten und gezüchteten Steinen aufrechtzuerhalten (durch Ausschlüsse, verzerrte Erzählungen und abwertendes Marketing), hat das Wachstum der Labor-Diamanten nicht nachgelassen. Immer häufiger greifen Menschen für Schmuck, wie einzigartige Eheringe, darauf zurück und lassen sich nicht von fehlleitenden Informationen abbringen.
Doppeldeutige Positionierungen stiften Verwirrung
Ein Beispiel ist auch Lightbox, eine Marke von De Beers, die Labor-Diamanten zu Niedrigpreisen anbietet, während sie den Prestigeanspruch weiterhin ihren Minensteinen vorbehält. Diese doppeldeutige Positionierung, die Labor-Diamanten in eine vermeintlich „niedrigere“ Kategorie drängen sollte, überzeugte nicht. Ihr Scheitern war absehbar. Ziel war nicht der reine Geschäftserfolg, sondern eine Schwächung des Images der Labor-Diamanten. Doch auch diese taktische Massnahme konnte einen längst begonnenen Wandel nicht aufhalten.
Erfolg der Labordiamanten schreitet weiter fort
Trotz aller Bemühungen um die Schädigung des Rufes der Labor-Diamanten, wird ihr Erfolg von einem wachsenden Bewusstsein für Transparenz und Nachhaltigkeit getragen. Sie setzen heute ihr eigenes Narrativ durch. Denn der wahre Konflikt betrifft nicht das Produkt selbst, sondern den nötigen Paradigmenwechsel. Was bei dem beschriebenen kalten Diamantenkrieg bekämpft wird, ist eine neue Vorstellung von Wert, die nicht mehr auf mythischer Erdherkunft beruht, sondern auf radikaler Transparenz, die die historischen Machtstrukturen des Luxus herausfordert.
Diesem Weg folgt auch AGUAdeORO. Als 2009 gegründetes Schmuckhaus mit Standorten in Genf und Zürich bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ethisch gefertigten Schweizer Schmuck zu erwerben und verfolgen den Anspruch, Nachhaltigkeit und Eleganz miteinander in Einklang zu bringen.
(Foto: Lucas Santos / Unsplash)

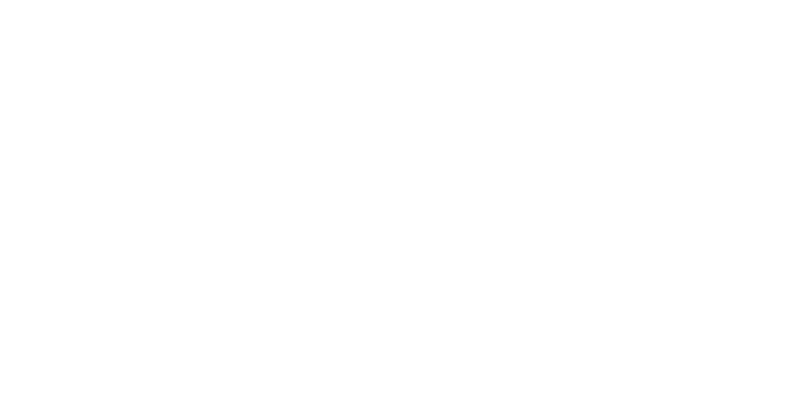



Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.